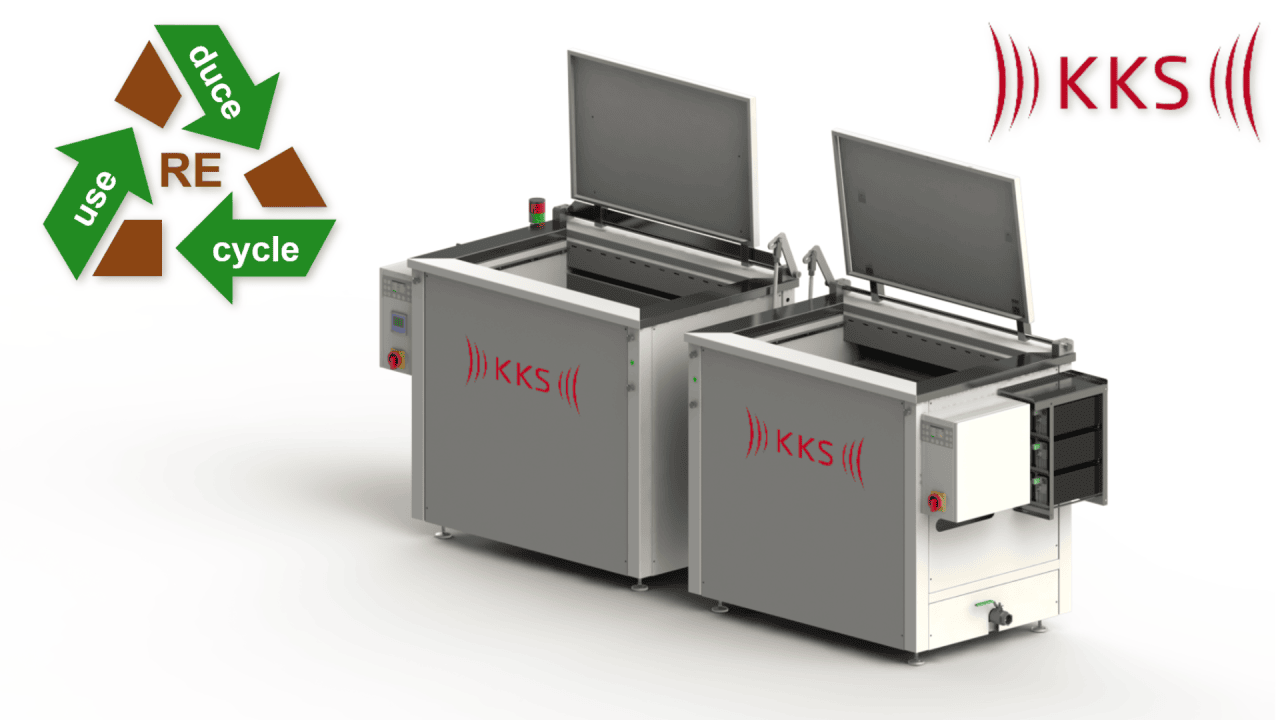Effizienz und Effektivität in wässrigen Reinigungsprozessen für Medizinprodukte
Der Artikel zeigt Massnahmen zur Effizienzsteigerung in wässrigen Reinigungsprozessen für Medizinprodukte nach den Prinzipien Reduce, Reuse, Recycle. Optimierungen wie Zeitschaltungen, Isolierungen und Rückgewinnungssysteme steigern Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Prozesssicherheit.
Einleitung
In der industriellen Fertigung sind wässrige Reinigungsprozesse unverzichtbar. Doch die steigenden Energie- und Wasserkosten, bedingt durch geopolitische Spannungen und wachsende Nachfrage, stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Prognosen deuten darauf hin, dass dieser Trend anhält, was effiziente und nachhaltige Prozesse zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor macht.
Die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die Verbesserung der Patientensicherheit sind zentrale Aspekte der Medizintechnik. Prozesse und Reinigungsverfahren müssen somit nicht nur wirtschaftlich und effizient, sondern vor allem effektiv und reproduzierbar sein. Gleichzeitig erwarten Stakeholder zunehmend, dass Unternehmen nachhaltige und ressourcenschonende Prozesse etablieren. Damit müssen entweder qualifizierte Anlagen oder validierte Prozesse angepasst werden. Die Auflösung dieses Spannungsfelds ist nicht trivial.
In diesem Artikel beleuchten wir die Schlüsselfaktoren, die die Reinigungsleistung beeinflussen. Zudem zeigen wir praxisnahe Lösungen auf, wie sich Effizienz und Effektivität von Reinigungsanlagen steigern lassen.
Einflussfaktoren der Reinigungsleistung
Die Effizienz und Qualität eines Reinigungsprozesses werden massgeblich von vier zentralen Parametern beeinflusst, die im sogenannten „Sinnerschen Kreis“ beschrieben sind:
- Temperatur des Reinigungsmediums
- Dauer des Reinigungsprozesses
- Chemische Zusammensetzung des Reinigungsmediums
- Mechanische Einwirkung
Diese Parameter müssen präzise auf die Anforderungen des Prozesses, die Eigenschaften des Werkstücks und den Grad der Verschmutzung abgestimmt werden. Veränderungen an einem Parameter erfordern in der Regel Anpassungen der anderen, um die gewünschte Reinigungsleistung zu gewährleisten. Gleichzeitig hat jeder Parameter direkten Einfluss auf die Reinigungsqualität und Patientensicherheit. Eine detaillierte Prozessanalyse ist daher essenziell, um alle relevanten Einflussfaktoren zu identifizieren und das Gleichgewicht zwischen Reinigungsqualität und Ressourceneffizienz zu finden. Zudem sollten die Prozessparameter auf ihre Robustheit geprüft werden, um den Ausschuss niedrig und die Patientensicherheit hoch zu halten. In der Regel ist eine neue Prozessvalidierung erforderlich.
Höhere Temperaturen erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit und verbessern die Löslichkeit von Verunreinigungen. Wird die Temperatur angepasst müssen biologische Laborwerte beachtet werden. Temperaturen bis 55 °C begünstigen die Bildung von Biofilmen. Dadurch kann die Keimbelastung/Bioburden im Reinigungsmedium ansteigen. Bei Zyklischen Temperaturschwankungen um 55 °C sterben die Keime ab und der Endotoxingehalt in der Reinigungslösung steigt.
Längere Einwirkzeiten führen in der Regel zu besseren Reinigungsergebnissen. Die Prozessdauer kann nicht in allen Reinigungsverfahren gleichermassen angepasst werden. Beispielsweise wird beim Passivieren von Stählen eine Mindestreaktionsdauer benötigt. Beim Beizen eines Stahls wird die Oberfläche stetig abgetragen wird. Damit werden nicht nur die Dimensionen des Werkstücks, sondern auch mechanische Eigenschaften beeinflusst.
Die Effektivität des Reinigungsmediums muss stets für die spezifischen Verunreinigungen validiert werden. Eine optimale Benetzbarkeit der Werkstücke und eine hohe Löslichkeit der Verunreinigungen im Medium sind entscheidend. Wenn die chemische Zusammensetzung der Reinigungslösung angepasst wird, kann sich die Zytotoxizität der Oberfläche verändern. Auch können Reste von schlecht abspülbaren Reinigungsmedien die Zytotoxizität negativ beeinflussen.
Mechanische Einwirkung kann helfen die Reinigungsleistung zu erhöhen. Verfahren wie Ultraschall, Druck oder die Bewegung des Mediums lösen Verunreinigungen schneller und effizienter. Sacklöcher und Kanülierungen können dadurch signifikant besser gereinigt werden. Zu hohe mechanische Einwirkungen können die Oberfläche auch beschädigen, besonders in manuellen Reinigungsprozessen. Dadurch können Späne und Partikel freigesetzt oder auch das Grundmaterial von bereits funktionalisieren Oberflächen (z.B. passiviert, poliert, farbanodisiert) wieder freigelegt werden.
Lösungen zur Steigerung des Effizienzgrads
Effizienzsteigerungen in wässrigen Reinigungsprozessen sind nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht lohnend. Neben den spezifischen Kostentreibern, die für jeden Prozess spezifisch optimiert werden müssen, können durch allgemeine Massnahmen Energie und Wasser eingespart werden. Ein bewährtes Prinzip ist die Abfallhierarchie: Reduce, Reuse, Recycle. Diese Ansätze können sowohl Energie- als auch Wassereinsparungen bewirken, wobei einige Lösungen beide Ressourcen optimieren. Eine Kombination der verschiedenen Lösungen ist zudem oftmals möglich. In der Regel wird eine Requalifizierung der Anlage und in einigen Fällen auch eine neue Prozessvalidierung notwendig.
Reduce: Isolierungen
Eine der effektivsten Massnahmen zur Reduktion von Energieverlusten in wässrigen Reinigungsprozessen ist die Isolierung der Tanks und Anlagen. Die Berechnung der Einsparung kann über den Wärmedurchgangskoeffizient, welche die Summe aus den Wärmedurchlasskoeffizienten einzelnen Schichten und der (konvektiven) Wärmeübergangskoeffizienten der Innen- und Aussenseite ist, erfolgen. Der effektive Energieverlust ist von der Oberfläche und dem Wannenmaterial des Beckens, sowie der Temperatur des Reinigungsmediums abhängig.
Die Wahl des geeigneten Dämmmaterials ist dabei entscheidend. Eine Reinraumumgebung oder ein Umfeld mit korrosiven Dämpfen kann die Auswahl der Dämmmaterialien einschränken. Extrudiertes Polystyrol und Phenolschaum zeichnen sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und moderate Kosten aus, sind jedoch mit 25 bis 50 mm relativ dick. Aerogele hingegen bieten bei nur 10 mm Dicke vergleichbare Dämmwerte, sind jedoch deutlich kostenintensiver. Die Preise pro Laufmeter variieren entsprechend. Während Aerogele durch ihre Platzersparnis bei engen Raumverhältnissen besonders vorteilhaft sind, bieten extrudiertes Polystyrol und Phenolschaum eine wirtschaftlichere Lösung bei ausreichend Platz. In jedem Fall sind Energieeinsparungen von weit mehr als 60 % realisierbar.
Zusätzlich zur Wannenisolierung sollten auch Verrohrungen aus Metall isoliert werden, da sie ebenfalls signifikante Wärmeverluste verursachen können. Besonders in beengten Platzverhältnissen können Aerogele aufgrund ihrer geringen Dicke und hohen Flexibilität Vorteile bieten. Alternativ können, je nach Einsatzgebiet auch Verrohrungen aus Kunststoff in Betracht gezogen werden.
Reduce: Abdeckungen
Ein wirkungsvoller Ansatz zur Reduzierung von Energie- und Wasserverlusten in Reinigungswannen ist der Einsatz von Abdeckungen. Offene Wannen führen zu erheblichen Verlusten, da Wärme und Wasser kontinuierlich verdunsten. Diese Verluste können durch die Verwendung eines Deckels signifikant reduziert werden. Ein Deckel hat drei Hauptwirkungen:
- Zwischen der Flüssigkeit und dem Deckel bildet sich eine isolierende Luftschicht, die den Wärmeaustausch verlangsamt.
- Die Luft über der Flüssigkeit wird rasch gesättigt, wodurch die weitere Wasserverdunstung begrenzt wird.
- Verdunstetes Wasser kondensiert am Deckel und fliesst zurück in die Wanne, wodurch Wasser- und Wärmeverluste verringert werden.
Ein Deckel ist besonders effizient, wenn es sonst über der Wanne zu Luftströmungen durch Absaugungen kommt. Hier sollten softwareseitige oder mechanische Lösungen vorgesehen werden, um die Absaugung bei geschlossenem Deckel zu minimieren. Ohne solche Anpassungen kann die isolierende Wirkung des Deckels beeinträchtigt werden, da der Luftstrom die gesättigte Luftschicht entfernt und somit die Verdunstung fördert. Eine entsprechende Grundabsaugung zur Sicherstellung des kontrollierten Abführens von gesundheitsschädlichen Dämpfen muss natürlich, wo nötig, entsprechend sichergestellt sein.
Nachteilig ist, dass sich am Deckel sich bei Temperaturen bis 55 °C Biofilme bilden. Wenn diese mit dem Kondensat in das Becken zurückfallen, kann die Keim- und/oder Endotoxinbelastung im Reinigungsmedium mit zunehmender Verwendungsdauer ansteigen. Daher muss über einen Rücktropfschutz das Zurückfliessen der Kondensflüssigkeit in hygienekritischen Anwendungen vermieden werden.
Reduce: Zeitschaltungen
Ein weiterer Ansatz zur Einsparung von Energie und Wasser in wässrigen Reinigungsprozessen ist die Nutzung von Zeitschaltungen. Dabei werden Anlagen gezielt ausserhalb der Betriebszeiten abgeschaltet, um den Wasser- und Energieverbrauch im Leerlauf zu reduzieren. Allerdings muss diese Massnahme stets anlagen- und prozessbezogen betrachtet werden, da sie nicht in allen Fällen Einsparungen bringt. Zum einen muss die eingesparte Energie jene überwiegen, die zum erneuten Aufheizen benötigt wird. Zum anderen können durch die zyklische Temperaturschwankung und stehende Reinigungsmedium die Keim- und somit Endotoxinbildung begünstigt werden. Dennoch kann diese Lösung bei Anlagen, die nur selten, in regelmässigen Intervallen oder mit erhöhtem Mediendurchflüssen betrieben werden, wirtschaftlich sinnvoll sein.
Reduce: Trocknungstechnologie
Die Trocknung von Werkstücken nach dem Reinigungsprozess ist ein wesentlicher, aber oft energieintensiver Schritt. Die Wahl des optimalen Trocknungsverfahrens hängt stark von den Materialeigenschaften der Werkstücke, den spezifischen Anforderungen und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab.
Metalle wie Titan haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit von etwa 22 W/(m⸱K) und eine Wärmespeicherzahl von 0.65 Wh/(m³⸱K). Diese Eigenschaften ermöglichen eine effiziente Wärmeaufnahme und -speicherung. Dadurch eignen sie sich besonders für Heisslufttrockner mit hohen Temperaturen, die eine schnelle Trocknung und kurze Zykluszeiten gewährleisten. Zudem können heisse Werkstücke nach dem Verlassen des Trockners ohne aktive Kühlung weiter trocknen, was den Energiebedarf reduziert und die Effizienz steigert.
Kunststoffe wie PEEK haben zwar eine ähnliche Wärmespeicherzahl von 0.49 Wh/(m³⸱K) jedoch weisen sie eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit von etwa 0.25 W/(m⸱K) auf. Diese geringe Wärmeleitfähigkeit erschwert die gleichmässige Erwärmung und birgt das Risiko lokaler Überhitzungen, wodurch die Materialeigenschaften beeinträchtigt werden können. Heisslufttrockner sind für solche Werkstoffe oft ungeeignet, da ihre Trocknung bei niedrigeren Temperaturen erfolgen muss. Kaltluft- oder Adsorptionstrockner sind hier von Vorteil, da sie eine präzise Feuchtigkeitskontrolle bei niedrigen Temperaturen ermöglichen und empfindliche Materialien schützen.
In allen Fällen kann die Keimbelastung/Bioburden indirekt reduziert werden, da Mikroorganismen ohne Feuchtigkeit die Lebensgrundlage entzogen wird. Im Fall des Heisslufttrockner werden zudem hitzeempfindliche Mikroorganismen abgetötet. Eine gezielte Sterilisierung kann dadurch jedoch nicht ersetzt werden.
Die Wahl des optimalen Trocknungsverfahrens von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter Materialeigenschaften, Qualitätsstandards und betriebliche Bedingungen. Während die Adsorptionstrocknung für präzise und sehr trockene Ergebnisse oft die beste Wahl ist, können Kaltluft- oder Heisslufttrocknung für weniger anspruchsvolle Anwendungen energieeffizientere und/oder kostengünstigere Lösungen darstellen.
Allgemein kann festgestellt werden, dass thermisch unempfindliche Metalle von Heisslufttrocknern durch kurze Zykluszeiten und hohe Effizienz profitieren. Für Kunststoffe oder Buntmetalle können Kaltluft- oder Adsorptionstrockner die bessere Wahl darstellen, da die thermische Belastung gering ausfällt und somit Phänomene wie Anlauffarben oder Verzug vermieden werden können.
Reuse: Spülkaskaden
Die mehrfache Spülung von Werkstücken ist ein wichtiger Bestandteil vieler Reinigungsprozesse und birgt ein erhebliches Potenzial zur Einsparung von Wasser und Energie. Durch den Einsatz von Kaskadensystemen kann das Spülwasser mehrfach genutzt werden, bevor es als Abwasser behandelt wird. Dieselbe Reinigungswirkung kann so mit weniger Spülwasser erzielt werden. Dies reduziert nicht nur den Gesamtwasserverbrauch, sondern auch die Energiekosten, da weniger Wasser aufgeheizt werden muss.
Das Spülkriterium (Rn) ist jenes Verhältnis zwischen der Konzentration im Prozessbad (c0) und dem letzten Spülbecken (cn). Bei einem Spülschritt es dem Verhältnis aus Spülwassermenge (Q) zur Verschleppung (V). Bei mehreren Spülschritten mit n Stufen gilt:
Es gibt keinen negativen Einfluss auf die in einer Spülkaskade gespülten Bauteile. Das Reinigungsmedium fliesst in diesem Fall entgegen dem Warenfluss. Dadurch können bei gleichem Mediumfluss in einem Kaskadensystem vielfach höhere Reinheiten erzielt werden als mit einzelnen Spülwannen.
Recycle: Kreisläufe
Geschlossene Wasserkreisläufe reduzieren den Frischwasserbedarf und senken Abwasserkosten erheblich. Sie ermöglichen die Wiederverwendung des Prozesswassers, wobei lediglich Verluste durch Verschleppung und Verdunstung ausgeglichen werden müssen.
Die Verluste durch Verschleppung und Verdunstung können im geschlossenen Kreislauf minimiert werden, indem das zurückgewonnene Wasser effizient gefiltert und wieder in den Prozess eingespeist wird. Besonders bei VE-Wasser lohnt sich der Einsatz eines Kreislaufsystems, da die Kosten für die Wasseraufbereitung durch den geringeren Bedarf und die potenziell geringere Belastung der Anlage deutlich sinken. Herausforderungen wie Biofilmbildung, die bei Temperaturen zwischen 25 und 55 °C auftreten kann, erfordern in der Medizintechnik den Einsatz von zusätzlichen Filtrations- und Desinfektionssystemen, sowie der regelmässigen Wartung der Filtrationstechnik.
Recycle: Wärmetauscher
Der Einsatz von Wärmetauschern in Reinigungsprozessen ermöglicht eine effektive Rückgewinnung von Energie aus Prozessmedien oder Abgasen. Wärmetauscher sind besonders bei kontinuierlich betriebenen Anlagen effizient, da sie das Wasser oder die Luft vorheizen, bevor zusätzliche Energie zugeführt werden muss. Die Kosten für die Implementierung sind abhängig von der Art des Wärmetauschers, seinem Wirkungsgrad und dem Platzbedarf.
Wärmetauscher können Nachteile mit sich bringen. Zum einen können hohe Volumenströme, wie sie im Heisslufttrockner auftreten, grössere Wärmetauscher erfordern, was Investitionen und Platzbedarf erhöht. Zum anderen können sich in den Wärmetauschern erneut zwischen 25 und 55 °C Biofilme bilden. In sensiblen Anwendungen, wie der Reinigung von Medizintechnikbauteilen, kann dies unerwünscht sein und zusätzliche Massnahmen wie regelmässige Reinigung oder der Einsatz spezialisierter, teurerer oder weniger effizienterer Wärmetauscher erfordern.
Fazit
Prozesse und Anlangen die in einem medizintechnischen Kontext betrieben werden, sind stets im Spannungsfeld zwischen Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeit bzw. Effektivität und Effizienz. Die Optimierung wässriger Reinigungsprozesse bietet sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile. Unternehmen können durch gezielte Massnahmen ihre Betriebskosten senken und gleichzeitig regulatorische Anforderungen erfüllen.
Die zentralen Einflussfaktoren der Reinigungsleistung – Temperatur, Einwirkzeit, chemische Zusammensetzung und mechanische Einwirkung – spielen eine entscheidende Rolle bei der Prozessoptimierung. Beachtet werden muss, dass die Auswahl von falschen Reinigungsparametern nicht nur zu einem schlechten Reinigungsergebnis, sondern mitunter sogar zu einer zusätzlichen Verunreinigung oder einer Beschädigung von funktionalisieren Oberflächen führen können. Eine präzise Abstimmung der genannten Parameter ermöglicht hingegen nicht nur eine verbesserte Reinigungseffizienz, sondern trägt auch zur Sicherheit und Qualität von Medizinprodukten bei. Daher sollten stets nur robuste und effektive Prozessparameter validiert werden.
Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz von wässrigen Reinigungsanlagen können anhand der Prinzipien Reduce, Reuse und Recycle untersucht werden. Optimierungspotenziale umfassen unter anderem Zeitschaltungen, Isolierungen und moderne Rückgewinnungssysteme. Beispielsweise können Spülkaskaden das Wasser mehrfach nutzen, während geschlossene Kreislaufsysteme den Wasserverbrauch erheblich reduzieren. Abdeckungen tragen effektiv zur Reduzierung von Energieverlusten bei, und die Wiederverwendung von Prozessmedien führt zu wirtschaftlichen Vorteilen. Diese Massnahmen sind nicht nur umweltfreundlich, sondern verbessern auch die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Eine Kombination aus technologischen Anpassungen und Prozessoptimierung ermöglicht es, Steigerungen von Effizienz und Effektivität zu erzielen. Damit kann die Wettbewerbsfähigkeit auch in einem streng regulierten Umfeld verbessert werde
Beitrag von